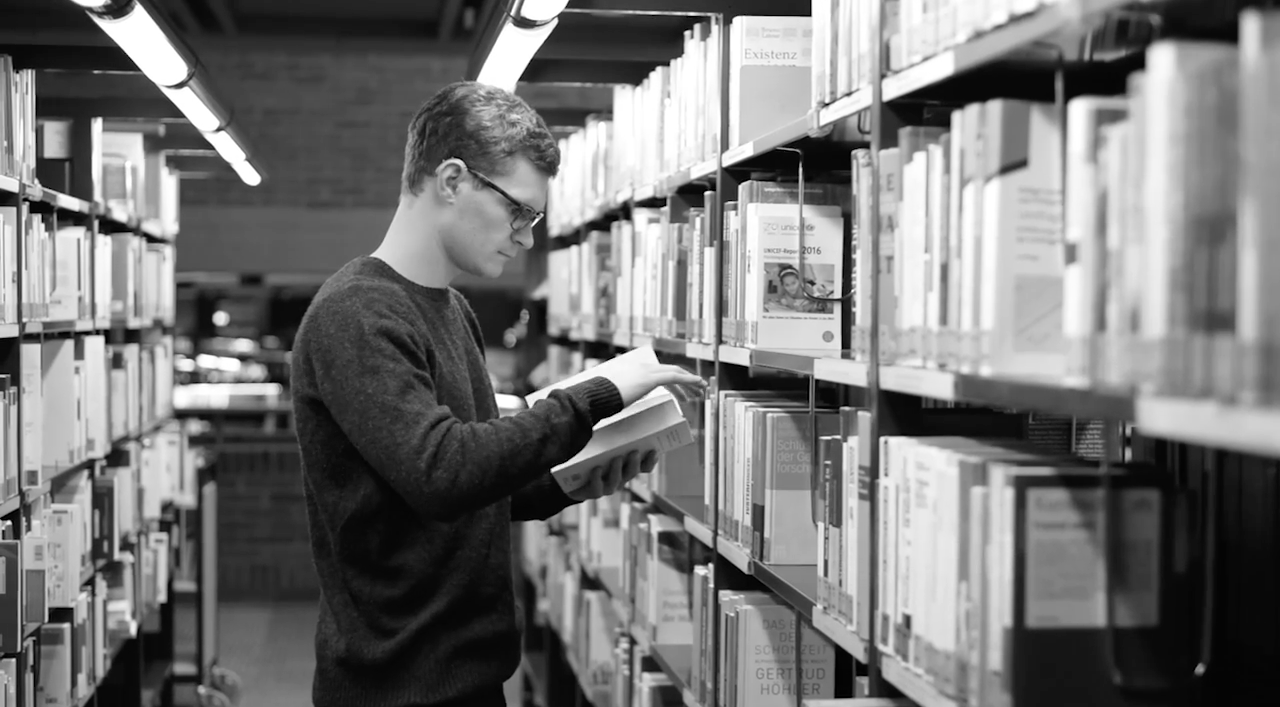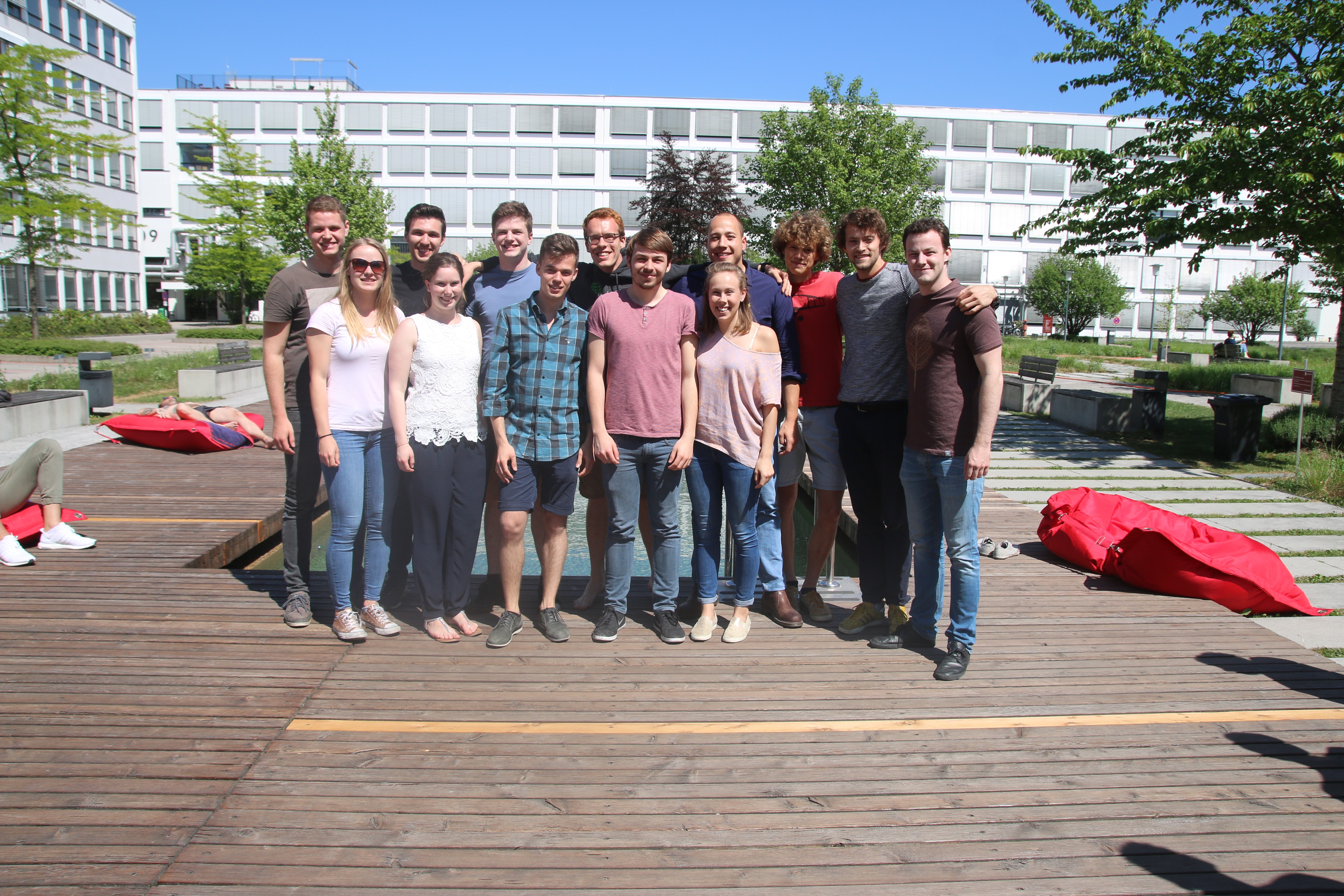Das Start-Up überkochen trägt mit seinem mobilen Kochwagen zur Umwelt- und Ernährungsbildung, aber auch zur Integration und Inklusion im Klassenzimmer bei.
Eifrig stecken die Schülerinnen und Schüler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums in München ihre Köpfe über den Rezeptkarten zusammen. Schon werden die Aufgaben verteilt, Schneidebretter und Messer aus den Schubladen gezogen, Wasser aufgesetzt – kurz nachgefragt: „Was heißt denn ‚siedendes Wasser‘?“ – und nach den nächsten Schritten geschaut. Nach kürzester Zeit riecht es im Klassenzimmer nach leckerem Essen, es wird gelacht, sich beraten und konzentriert zugeschaut. Am Ende dieser zwei Schulstunden wird gemeinsam gegessen – ganz ohne Besteck und ohne „Das kenne ich nicht. Das mag ich nicht“, – wird alles mal probiert. Die Gründer von überkochen sind zufrieden – Lehrer und Klasse auch. So hatten sie sich das vorgestellt.

Englisches Porridge – hört sich für die Schüler*innen doch irgendwie besser an als Haferschleim.
Biologie, Mathe, Geschichte und Integration – Kochen und Essen kann so viel mehr sein als bloße Nahrungszubereitung und -aufnahme. Dies zu vermitteln und Zusammenhänge zu den Lebenswelten der Schüler*innen herzustellen, hat sich der Münchner Verein überkochen e.V. zur Aufgabe gemacht.
Inklusion durch Kochen
Entstanden ist die Idee während des ersten Mastersemesters von Constanze Buckenlei und Marco Kellhammer am Lehrstuhl für Industrial Design der TU München. In Kooperation mit der Hans Sauer Stiftung wurde unter dem Thema „Schule designen“ an der Südschule in Bad Tölz recherchiert. Zu diesem Zeitpunkt gab es an der Schule zwei Willkommensklassen, die aus Geflüchteten bestanden und nur wenig Kontakt zu den einheimischen Schüler*innen hatten. Die Gruppe von Constanze und Marco beschäftigte sich mit dem Thema Ernährung und entwickelte ein Konzept, wie man durch Essen Integration und Inklusion schaffen kann: gemeinsam kochen. „In der Schule ist die Pause und das Essen immer der Zeitrahmen für die Schüler, in dem sie ihre Freunde treffen, wo sie Verbindungen schaffen und sich austauschen. Genau dieses Erlebnis wollten wir auch im Unterricht erzielen“, sagt Constanze.
Statt dem klassischen Frontalunterricht, sollte ihr Konzept offener und partizipativer werden. Daher entwickelten sie eine mobile, unabhängige Kochstelle, die in jeder Klasse genutzt werden kann. Am Ende des Semesters entstand der erste selbst gebaute Prototyp. Dass das Projekt weiter verfolgt werden konnte, lag vor allem auch an dem Interesse der Stiftung und des Referats für Bildung und Sport der Stadt München. So entwickelten Constanze und Marco die Idee im zweiten Semester weiter und konnten es auch unter unternehmerischen Gesichtspunkten ausarbeiten.

Das Team von überkochen (von li nach re): Marco, Constanze und Vasiliki (c) Christoph Eipert
Damit der Kochwagen auch ohne große Anleitung genutzt werden kann, erdachten sich Constanze und Marco ein Kartenset mit Rezepten, Aufgabenverteilung, Informationen über Nahrungsmittel und Aktionskarten, die sie in Kooperation mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen und dem Studiengang Lebensmittel, Ernährung und Hygiene entwickelten. Die dritte im Bunde, Vasiliki Mitropoulou, Lehrerin für Informatik und Wirtschaft, hatte das Projekt als Mitarbeiterin der Hans Sauer Stiftung in der Entstehung beobachtet und stieg in das Projekt ein, als es an die Entwicklung einer Modellphase mit der Stadt München ging. Sie unterstützte bei dem didaktischen Teil der Entwicklung des Kartensets und ergänzender Workshops. So hat sich der Kochwagen von überkochen weiterentwickelt, von einem Integrations- und Inklusionsmittel zu einem Unterrichtstool, das in jedem Fach miteingebunden werden kann.
Die verwendeten Materialen für den Kochwagen sind robust, funktional und einfach wiederzubeschaffen. Gefertigt wird in der Justizvollzugsanstalt in Niederschönenfeld. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass sie in einer sozialen Einrichtung gefertigt werden sollen und das hat schließlich auch funktioniert. Trotz kleiner Herausforderungen, ist es insgesamt sehr positiv und wir erfahren eine umfangreiche Unterstützung seitens der Werkstätten“, sagt Marco.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
Auch eine Entscheidung zum Thema Unternehmensgründung mussten die drei treffen – eine Form, die mehr der ideellen Idee als der eines Business entsprechen sollte und außerdem wenig Investitionskosten fordert. So wurde im März 2018 mit vier weiteren Freunden der überkochen e.V. gegründet. Damit stand den weiteren Plänen nichts mehr im Wege. Nach einem Stadtratsbeschluss Münchens gab es eine öffentliche Ausschreibung eines Ernährungskonzepts – den Zuschlag bekam überkochen und somit zehn weitere Schulen die Möglichkeit, sich für die Kochwagen zu bewerben, die nun jedes Jahr rotieren sollen. Dementsprechend gefragt war das Team Anfang September an den Schulen, um Einführungsworkshops an Gymnasien, Grund-, Mittel-, Real- und Berufsschulen zu halten. Die Wägen werden vielseitig eingesetzt, zum Beispiel als erste Möglichkeit der Interaktion in Grundschulen mit vielen fremdsprachigen Kindern oder fachspezifisch an den höheren Schulen – die Lehrer sind jedenfalls hoch motiviert und arbeiten auch unabhängig von den Lernkarten.

Der Wagen von überkochen ist mit allem ausgestattet, das man zum Kochen braucht.
Nicht nur das Angebot, sondern auch das Team von überkochen hat sich erweitert. Neben den unterstützenden Vereinsmitgliedern, gibt es nun zwei Ökotrophologinnen – darunter auch eine mit der Zusatzausbildung zur Stressbewältigung – die das Workshopangebot ergänzen.
2018 – das Jahr der Auszeichnungen
Mit ihrer Idee haben sie sich außerdem bei vielen Wettbewerben für Social Entrepreneure beworben und waren mehr als erfolgreich: 1. Preis beim Social Business Wettbewerb der Joblinge und Hogan Lovells, eine Auszeichnung als Kultur- und Kreativpiloten der Bundesregierung mit umfangreichen Workshopprogramm und Einladung ins Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, sowie unter den 100 Stipendiaten des Start Social Programms. Die Preise machten auch einige Organisationen auf überkochen aufmerksam, wie die Sarah Wiener Stiftung, die sich den Wagen von überkochen nach Berlin für ein Projekt auslieh.
Bisher war überkochen – wie der Name schon sagt – mehr auf das Bindeglied Kochen fokussiert und wie dadurch etwas vermittelt werden kann. Durch die Arbeit an den Schulen hat das Team aber gemerkt, dass der Wagen noch viel mehr Möglichkeiten bietet. Der Fachraummangel an Schulen könnte so zum Beispiel durch spezielle Chemie- und Physikwagen teilweise abgefangen werden. Ideen gibt es noch viele – und langweilig wird dem überkochen-Team auch 2019 definitiv nicht.
(c) Alle Bilder überkochen