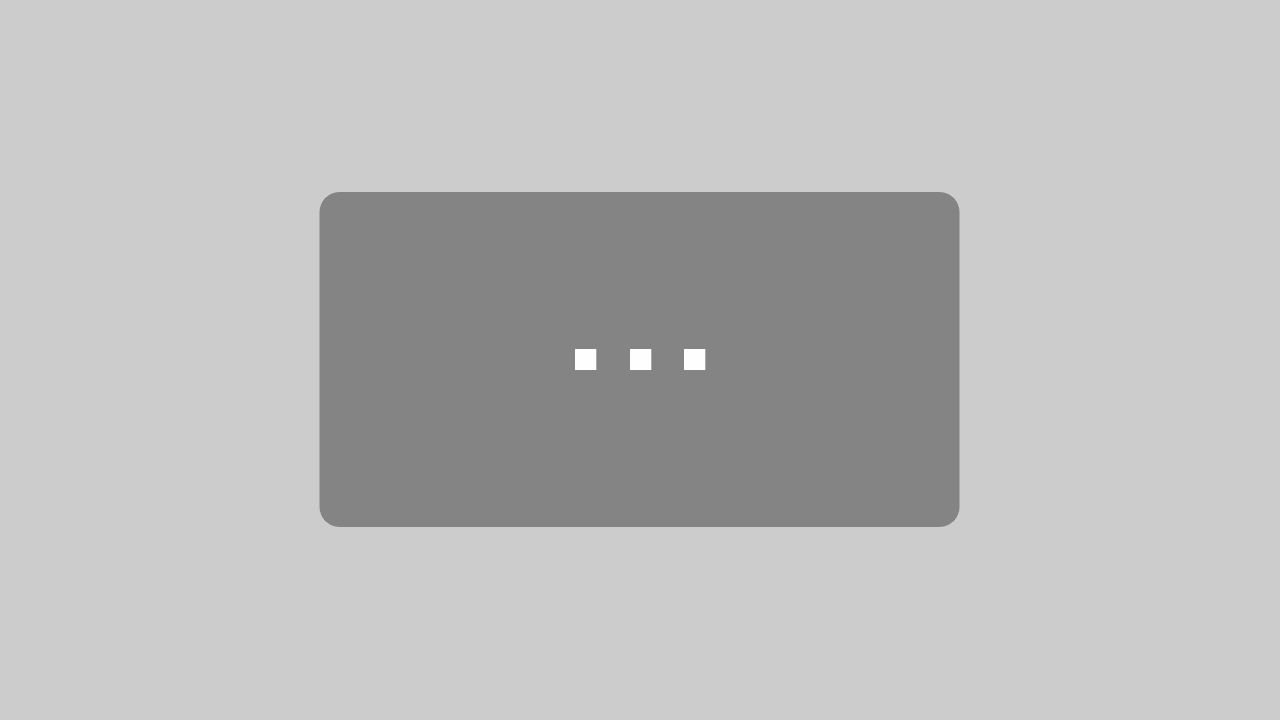Elektro-Scooter sind in kürzester Zeit ein nicht mehr wegzudenkendes Fortbewegungsmittel in vielen Großstädten geworden. Aber die Sache hat einen Haken: wirklich nachhaltig sind sie nicht.
Pünktlich zum Sommerbeginn hat auch in deutschen Großstädten die schöne neue Mobilitätswelt Einzug gehalten. Musste man bis vor kurzem noch die eigene Muskelkraft bemühen, um sich von der einen zur anderen Ecke der Stadt zu bemühen, funktioniert das nun schon seit ein paar Monaten auch ganz bequem elektrisch. Denn so ist es seit Juni auch hierzulande erlaubt, den täglichen Weg zur Arbeit, zum Sushi-Schnellimbiss oder zum nächstgelegenen Badespot mit einem sogenannten E-Scooter zurückzulegen. Verschiedene Anbieter buhlen dabei um die Gunst der Menschen, die möglichst einfach und mobil die Stadt erkunden wollen. Das Zauberwort der Stunde heißt dabei Mikromobilität. Sie umfasst all diejenigen Fortbewegungsmittel, die sich keiner starren Infrastruktur bedienen und dabei eher für kurze, spontane anstatt für lange Strecken ausgelegt sind. Auf diesem Mikrolevel soll Mobilität neu erfunden werden. Man könnte aber auch einfach sagen, sie soll individueller werden. Denn mit Hilfe von E-Scootern und Co. kann jeder selbst entscheiden wann und wo die Fahrt losgehen soll. Kollektives Zusammenpressen in überfüllten U-Bahn-Wagons soll damit ein für alle Mal der Vergangenheit angehören.
Kleine Rollen, großer Abdruck
Das klingt alles erstmal ziemlich gut, wenn man aber genauer hinsieht, tauchen schnell erste Zweifel auf. So lässt sich fragen, ob es denn überhaupt diese Massen an Elektroroller braucht, die nicht selten Radwege blockieren oder mitten auf Gehwegen achtlos abgestellt werden. Abgesehen davon und von dem erhöhten Unfallrisiko, die der Nutzung solcher Gefährte nachgesagt wird, scheint doch aber eine ganz andere Frage interessant zu sein: Können E-Scooter einen Beitrag zur Verkehrswende leisten?
Geht es nach den Anbietern derartiger Mobilitätsangebote, soll genau das mit den bunten Rollern erreicht werden. Das schwedische Unternehmen „Voi“ etwa wirbt auf dessen Website damit, dass durch den Einsatz der eigenen Rollerflotte bereits über 900.000 Tonnen CO2 gegenüber der gleichen Streckennutzung durch Mittelklassewagen eingespart werden konnten. Aber so richtig nachweisen lässt sich das noch nicht und die Zahlen, die online auftauchen, lassen passende Quellen noch kläglich vermissen. Ein Studie von Forschern der North Carolina State University hat jetzt aber erstmals valide Daten über die Emissionsbilanz US-amerikanischer Sharing-Anbieter geliefert. Das Ergebnis: E-Scooter sind keinesfalls so nachhaltig wie oft behauptet.

Die Auswertung der Nutzungsdaten ausgeliehener E-Scooter lässt vermuten, dass diese vermutlich nur eine Lebensdauer von 29 Tagen besitzen. (c) Claudio Schwarz.
Laut dieser Studie ist es vor allem die Herstellung der Scooter sowie das meist PKW-betriebene, tägliche Einsammeln und Ausliefern der ladebedürftigen Scooter, die im wesentlichen zu einer schlechten CO2-Bilanz der Scooter beitragen. Rechnet man diese Faktoren in die Nutzung von E-Scootern mit ein, ist der ökologische Fußabdruck vergleichbar mit dem eines PKWs mit einem ungefähren Verbrauch von 10 Litern pro 100 Kilometer. Gar nicht mal so gut. Das Ergebnis der Ökobilanz ist dabei vor allem abhängig von der geringen Lebensdauer der Elektroroller. So hält momentan ein E-Scooter der Witterungsverhältnissen und der täglichen Nutzung lediglich 28.8 Tage stand. Das ergab zumindest die Auswertung der Nutzungsdaten eines Verleihers von E-Scootern in der US-amerikanischen Metropole Louisville Trotz solcher miesen Ergebnisse für die Umwelt sollen in Städten wie München bis zu 10.000 der rollenden Gefährte abgestellt werden. Keine guten Zahlen für die Umwelt also.
Viel Geld und wenig Verantwortung
Mehr als gut hingegen dürfte sich das Geschäft mit den E-Scootern für die Betreiber*innen solcher Sharing-Angebote auszahlen. Warum das so ist, hat die Unternehmensberatung McKinsey mit einer eigenen Studie herausgefunden. So sind die Hürden zum Markeintritt für E-Scooter-Verleiher*innen aufgrund geringer Anschaffungskosten sehr niedrig. Hinzu kommt, dass sich die Anschaffungskosten der E-Scooter schon mit wenigen Fahrten am Tag amortisieren. Das Marktpotential ist dabei riesig, denn die Roller kommen gut an. Laut dieser Studie ist es vor allem die Möglichkeit, kurze Strecken in überfüllten, urbanen Gegenden einfach und bequem zurücklegen zu können, die eine hohe Nachfrage auf der Nutzerseite erklärt. So finden immer mehr Nutzer*innen Gefallen daran, draußen, im Freien unterwegs zu sein und eben nicht in endlosen Staus festzustecken. Anbieter wie VOI, Lime oder TIER können sich dabei auf riesige Gewinnmargen freuen. So wird vorausgesagt, dass mikromobile Sharing-Angebote in China, Europa und den USA spätestens bis 2030 einen jährlichen Umsatz von 300 bis 500 Milliarden US-Dollar generieren werden.

Wer als „Juicer“ E-Scooter über Nacht einsammelt, auflädt und am Morgen wieder verteilt, bekommt meist weniger als einen gesetzlichen Mindestlohn ausgezahlt. (c) Markus Spiske
Ob es bei der Erwirtschaftung solcher massiven Gewinne fair zugeht, steht auf einem anderen Blatt. Lässt sich aufgrund des jungen Alters der meisten Sharing-Anbieter*innen noch nicht genau sagen, ob dessen Mitarbeiter*innen faire Arbeitsbedingungen vorfinden, kommen hierzu jedoch erste Zweifel auf. So bekommt laut Recherchen der Zeitschrift taz ein Juicer – also jemand,der die leeren E-Scooter abends einsammelt, auflädt und am Morgen wieder in der Stadt verteilt – pro geladenen Roller in Berlin vier Euro vom Sharing-Anbieter Lime ausgezahlt. So ein „Juicer“ ist dabei aber keineswegs bei dem Unternehmen eingestellt, sondern arbeitet diese*r selbstständig und muss daher für alle laufenden Kosten für Internet, Versicherung, Steuern, Benzin, das eigene Fahrzeug und den Strom für die Akkus selbst aufkommen. Die Auftraggeber aber umgehen somit einfach und bequem Forderungen nach Mindestlöhnen und entziehen sich somit ihrer sozialen Verantwortung. Gar nicht mal so fair also. Ob derartige Geschäftsmodelle in Zukunft Bestand haben können und dürfen steht vielleicht noch in den Sternen, eines dürfte aber bereits jetzt schon klar sein: Verkehrswende geht anders.