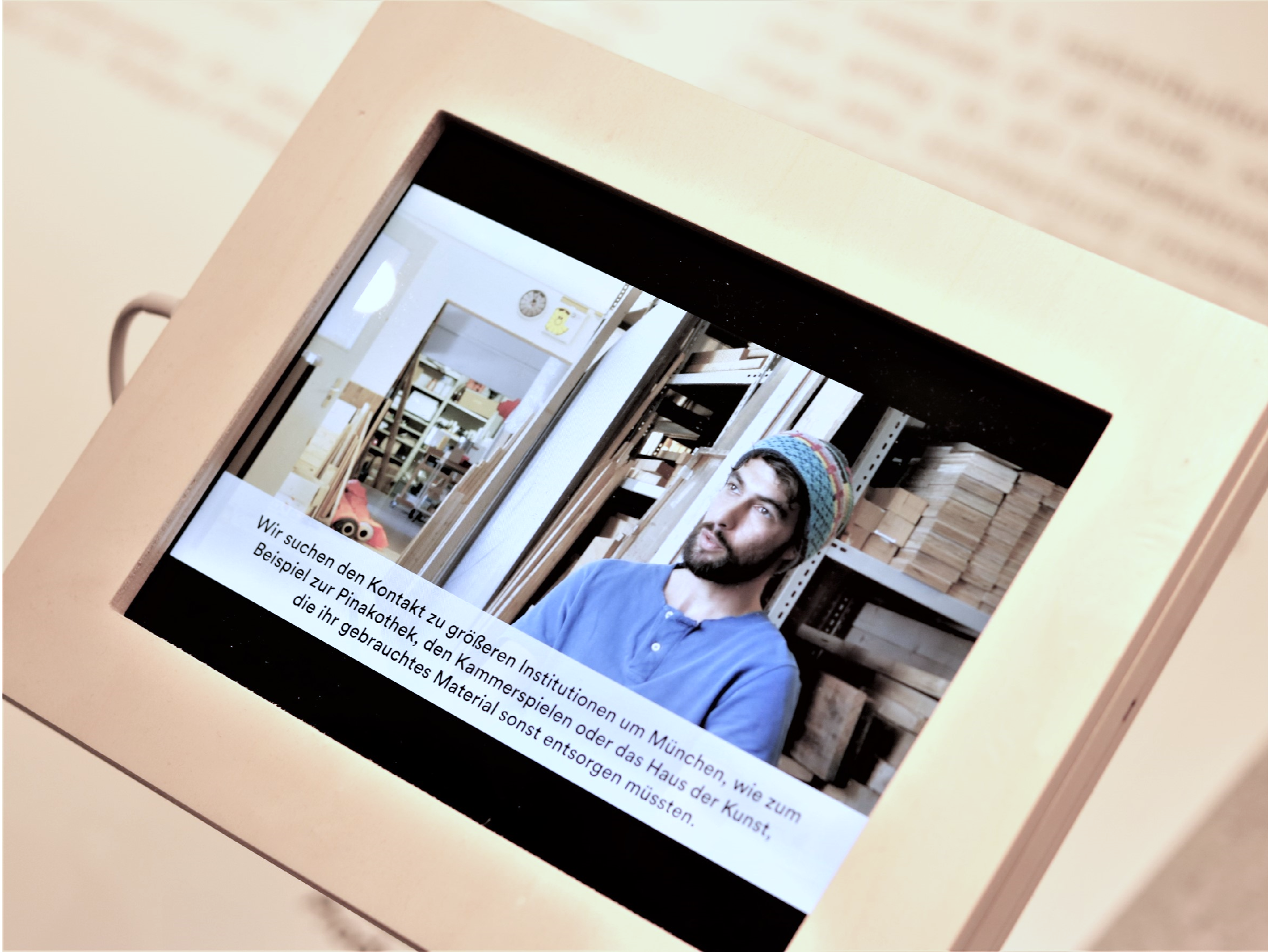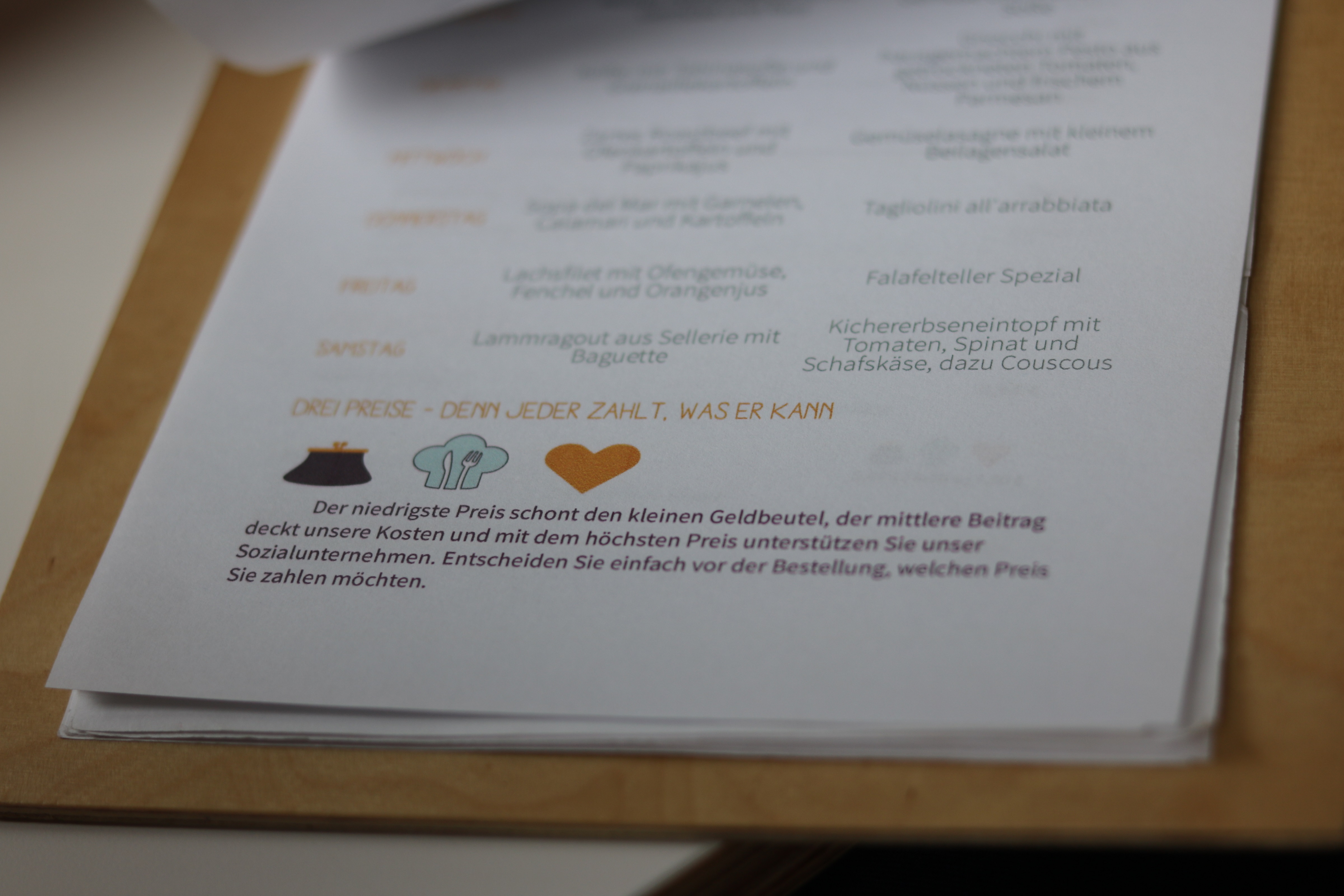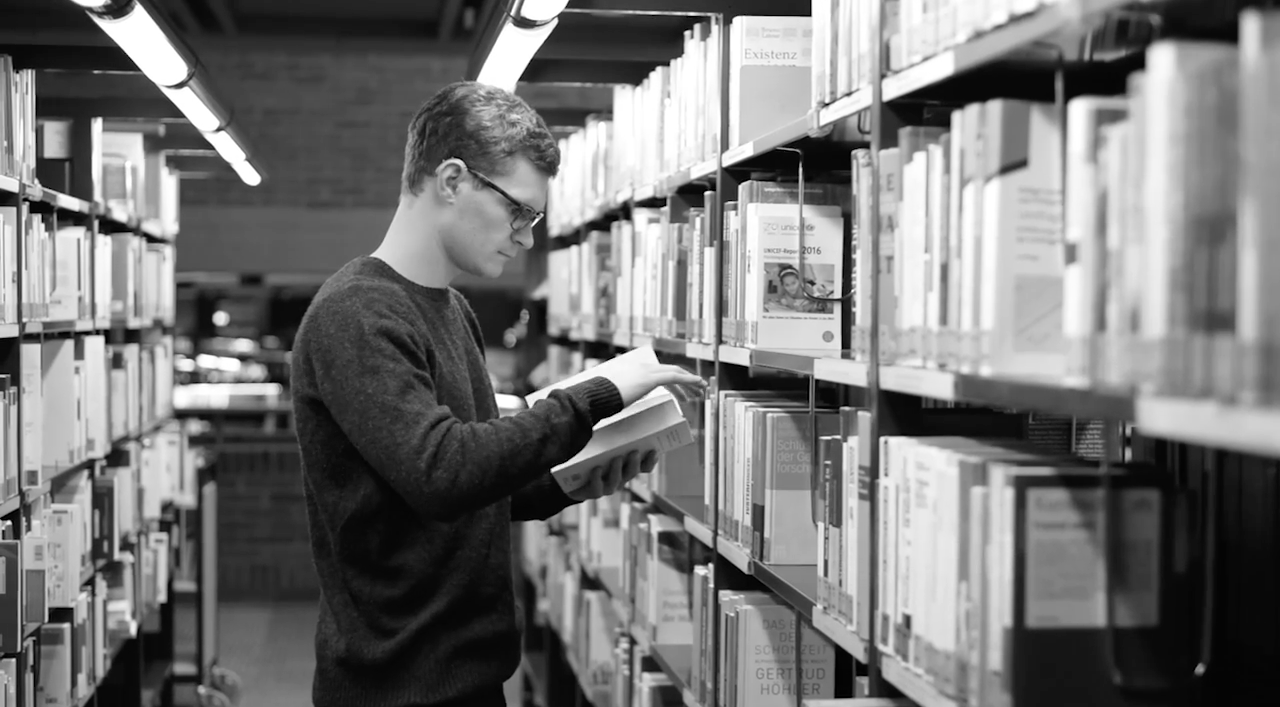München macht Geschäfte
Um die elf Euro gibt man auf der Wiesn heuer für einen Liter Bier aus. Der ist meist schnell ausgetrunken und selten bleibt es bei einer Maß. Dann noch ein Hendl, Kassspatzen und ein Herzl und schon ist der Geldbeutel gut geleert. Und irgendwie ist es dann auch schon egal. Denn die Wiesn ist für viele nun mal etwas Besonderes und ein Anlass, sich auch mal was zu gönnen und nicht jeden Cent umzudrehen. Nicht unüblich ist sogar das extra Wiesntaschengeld, welches manch Ü20-Enkel immer noch von der Oma zu gesteckt bekommt.
In Zahlen lässt sich das so zusammenfassen: Im Jahr 2018 haben ca. 6,3 Mio Besucher knapp 8 Mio Maß getrunken. Dabei wurden in München während der Wiesnzeit ca 1,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist eine Menge Holz. Und viele Münchner profitieren vom größten Volksfest der Welt – ob als Gastronom, Taxifahrer oder aber auch als Studierender, der das WG-Zimmer für ein paar Nächte untervermietet.
Die Münchner Tafel e.V.
Die Wiesn drückt Münchner Lebensgefühl aus und gilt als fünfte Jahreszeit in der bayerischen Hauptstadt. Und obwohl es ein Fest fürs Volk ist, gibt es einige unter uns, die nicht dabei sein können. In der bayerischen Hauptstadt leben ca 250.000 Menschen unterhalb der Armutsgrenze und können dabei von einem Wiesnbier nur träumen. Ca. 20.000 Menschen werden deshalb jede Woche von der Münchner Tafel e.V. mit Lebensmitteln versorgt und unterstützt. 650 Ehrenamtliche kümmern sich darum, dass die jährlich über 6,5 Millionen Kilo Lebensmittel an verschiedenen Ausgabepunkten der Stadt gerecht verteilt werden. Die Münchner Tafel gehört mit zu den wichtigsten unabhängigen Institutionen zur Unterstützung von sozial Schwächeren und rettet ganz nebenbei große Mengen an Lebensmitteln, die sonst weggeworfen würden.
Wenn alle von der Wiesn-Gaudi profitieren
Deshalb ruft Prostspenden dazu auf, für jede getrunkene Maß (Bier, Wein oder Kaffee, …) einen Euro an die Münchner Tafel bzw. an Prostspenden zu spenden. Dabei geht es nicht nur darum, alle Münchner an diesem Fest teilhaben zu lassen, sondern auch darum, die Wiesnbesucher für die Themen der Lebensmittelverschwendung und der Armut – in einer schillernden Stadt wie München – zu sensibilisieren.
Prostspenden kann man ganz einfach über die Website, aber man findet auch hier und dort einen Sammelkrug – meist im Büro der Wiesnwirte.
In diesem Sinne: Auf eine friedliche und etwas sozialere Wiesn!
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.