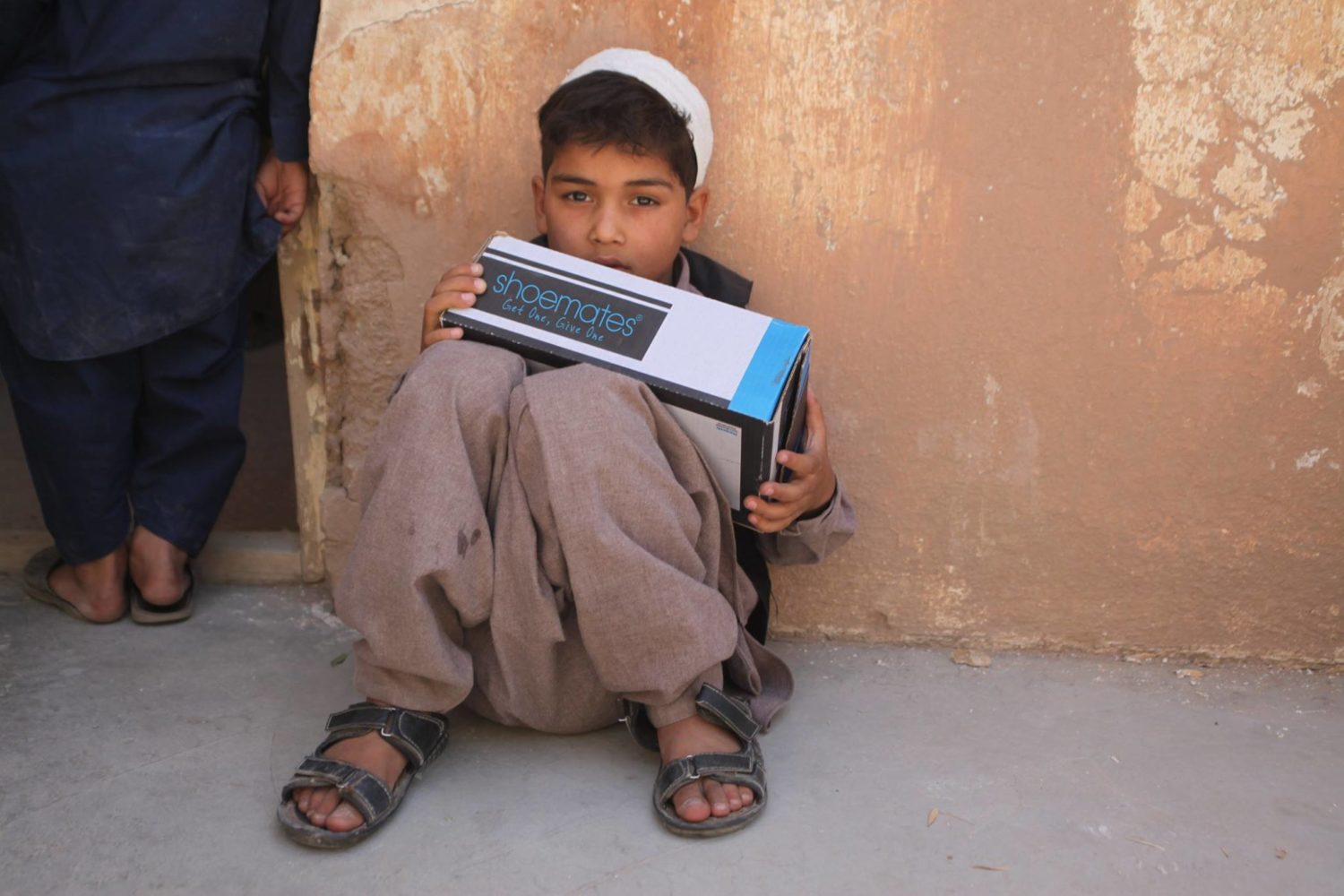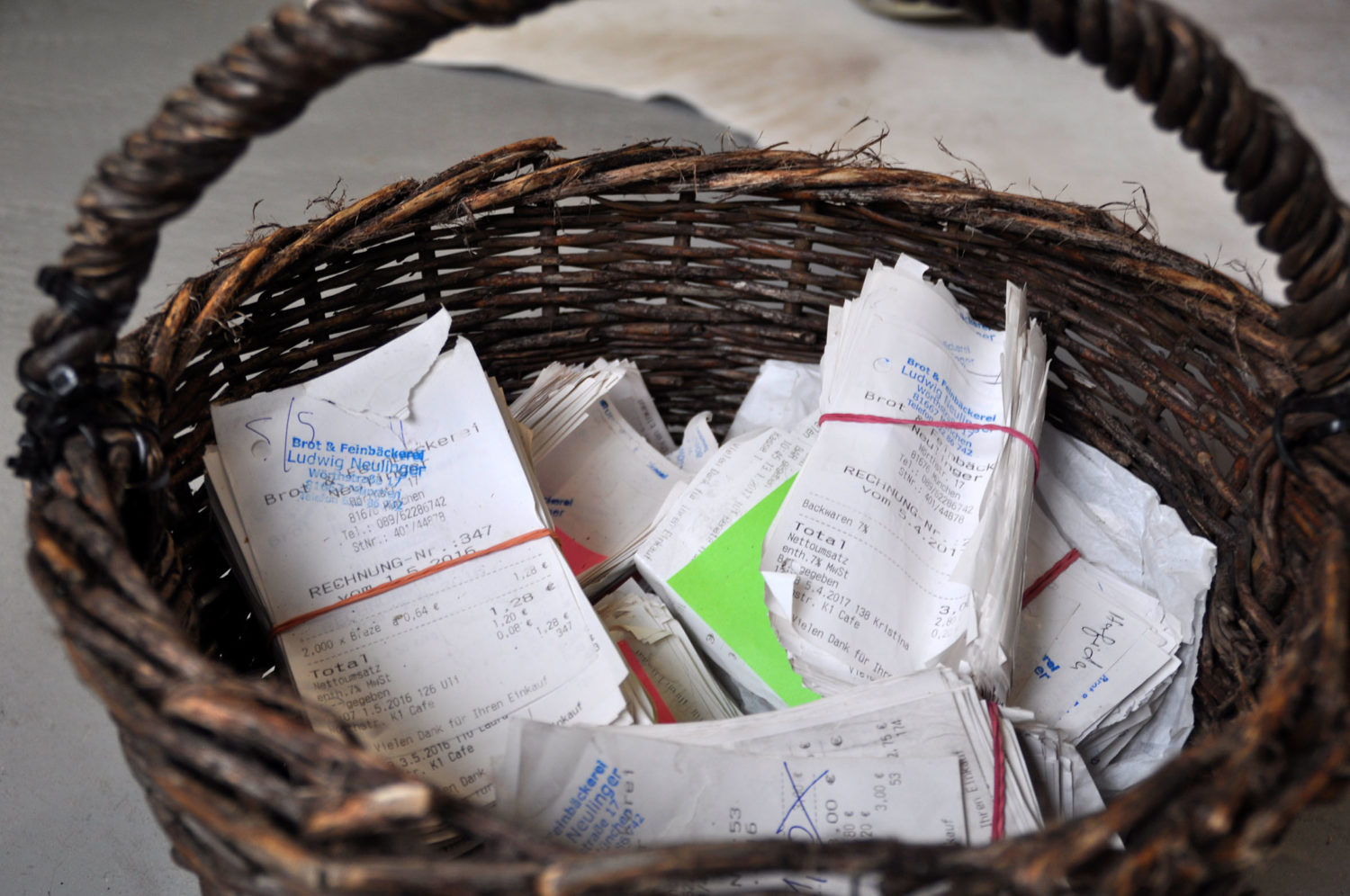Der Industriedesigner Nils Enders-Brenner hat ein Gerät entwickelt, dass die Menschen zu mehr Sprechkultur erzieht.
Eine Gruppe Studierender sitzt zusammen und diskutiert den durchgenommenen Stoff. Ein Student spricht. Plötzlich fällt ihm eine Studentin ins Wort und auf einmal reden alle durcheinander. Nicht gerade höflich und für jeden etwas schwierig – aber an sich eine ganz normale Situation, solange man alles hört. Doch wenn eine Person dabei ist, die schwerhörig oder taub ist, dann ist es ein Ding der Unmöglichkeit einer solchen Diskussion zu folgen. Um seine Mitstudierenden in so einem Moment auf ihr Handeln Aufmerksam zu machen, hat Nils Enders-Brenner den Störer entwickelt. Ein Gerät, das in dem Augenblick, wenn eine Person zu schnell oder laut spricht oder jemanden unterbricht, ein Störgeräusch von sich gibt und signalisiert, dass gerade etwas nicht passt.
Schon während des Bachelorstudiums in Kunst und Design an der Universität Bozen, hat Nils das Thema zwischenmenschliche Kommunikation begleitet. Nach einem Auslandsjahr in Schweden im Anschluss an seinen Bachelor verschlug es ihn für den Masterstudiengang Industrial Design nach München. Bei der Suche nach einem Thema für seine Masterarbeit, entdeckte er die Methode des Experience-Designs für sich: „Dabei denkt man weniger an die Lösung, sondern setzt sich erst einmal an die Recherche und Forschung und versucht daraus etwas zu entwickelt.“
Ein kulturelles Problem?
Beim Interview von hörgeschädigten Studierenden an der LMU in München, kristallisierten sich drei Hauptprobleme heraus, die die Probanden hatten. Erstens: Professoren, Mitarbeiter und Studierenden wissen nicht, wie sie mit Hörgeschädigten kommunizieren sollen. Zweitens: Die Trennung zwischen Hörenden und Hörgeschädigten, beispielsweise durch unvollständige Mitschriften (da diese nie ganz vollständig sein können) oder Gebärdendolmetscher (wobei nicht jeder Gehörlose die Gebärdensprache versteht, besonders wenn sie von den Lippen ablesen können). Drittens: Die Schwierigkeiten, die in Lerngruppen auftreten und dazu führen, dass Hörgeschädigte selten daran teilnehmen. „In Italien und Amerika ist das beispielsweise anders, die sind freundlicher und offener. In Deutschland gibt es da nicht so eine große Bereitschaft sich ‚einzuschränken‘ bzw. anderen mehr entgegenzukommen“, sagt Nils.

Nils Enders-Brenner mit dem Prototyp des Störers.
Was also tun? Normalerwiese wird ein Produkt, laut Nils, dem Menschen angepasst. In diesem Fall ist es aber umgekehrt, denn der Mensch muss sich hierbei an das entworfene Objekt anpassen und beispielsweise seine Sprechgeschwindigkeit reduzieren. Nils hat also weitergeforscht, mit Hörenden Gruppen und gemischten Gruppen von Hörenden nicht Nicht-Hörenden. Die gemischte Gruppe stellte sich als viel effizienter raus. Die hörenden Studierenden verstanden im Austausch besser die Probleme der Hörgeschädigten. Entwickelt wurden daraus vor allem App-Ideen, die bei Nils nicht auf Zuspruch stießen: „Bei einer App ist man immer vom Smartphone abhängig, daher kam das für mich nicht in Frage.“
Sprecherziehung für Hörende
Der Störer – wobei dieser Name noch nicht final ist – kommt ganz schlicht daher. Eine Runde, schwarz-graue Box, in der Mitte ein kleines Loch mit einem Mikrophon. Wenn der Störer dann erst mal angeschaltet ist, versteht man das Konzept schnell: spricht man zu schnell oder sind die Hintergrundgeräusche zu laut, gibt er ein unangenehmes Brummen von sich. Das irritiert erst mal. „Wenn das dann öfter passiert, lernt man langsamer und deutlicher zu sprechen, sodass auch ein Hörgeschädigter ohne Probleme von den Lippen ablesen kann“, sagt Nils.
Aber der Störer kann auch in anderen Bereich genutzt werden. Wie zum Beispiel als Präsentationstrainer, um eine bestimmte Sprechgeschwindigkeit beizubehalten, in Schulen, wenn die Kinder zu laut sind oder wenn ein Gebärdensprachdolmetscher dabei ist und der Redner selber zu schnell spricht, erinnert ihn der Störer daran, dass er langsam reden muss, damit die Gebärden auch zeitgleich das Gesagte wiedergeben können.

Nils Enders-Brenner im Oskar-Miller-Forum während der Munich Creative Business Week.
Im Zuge seiner Masterarbeit hat Nils auch ein einmonatiges Stipendium der Hans Sauer Stiftung für den MakerSpace der TU München bekommen. „Die Zeit im MakerSpace hat mir Sicherheit und Motivation gegeben selber mit dem Lötkolben zu arbeiten – da war ich mir vorher immer unsicher. Ich wollte in dieser Zeit vor allem Dinge lernen und beobachten, wie gewisse Dinge funktionieren“, sagt Nils.
Nils arbeitet daran, dass der Störer kleiner wird und noch weniger auffällt. Daher soll er bestenfalls am Ende aus Holz und Kork bestehen. Statt einem Mikrofon soll es mehrere geben, damit das Gerät auch in größeren Gruppen funktioniert. Interessenten, wie die Dolmetscher-Studierenden der Hochschule Landshut, gibt es bereits. Mit ihnen plant Nils eine längere Testphase, um den Störer zu perfektionieren. Dafür will er aber zuerst eine Software entwickeln: „Damit soll das Gerät einfacher zu bedienen sein, also auch für Menschen, die keine Codesprache beherrschen.“ Der soziale Mehrwert seiner Arbeit ist ihm bei allem, was er entwickelt, sehr wichtig. „Für mich ist der soziale Mehrwert eine Selbstverständlichkeit.“ Und das Thema ist ihm auch ein persönliches Anliegen – Nils ist selbst hochgradig schwerhörig.
(c) Alle Bilder: Daria Stakhovska